Fahr'n, fahr'n, fahr'n auf der Datenautobahn?
Kleine Didaktik der Internetnutzung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehr-Lern- |
Lösung durch Verwendung des Internets als | |||
|---|---|---|---|---|
| Vorbereitung | Lern- gegenstand |
Lern- medium |
Politik- medium |
|
| Datenflut | -- |
|
--- |
? |
| Zeitknappheit (Menge) | - |
|
--- |
|
| Zeitknappheit (Frist) | + |
|
+ |
+ |
| Aktualität | ++ |
? |
+ |
+ |
| Schülerbezug |
|
? |
? / + |
? |
| Verständlichkeit | ? |
? |
- |
? |
| Textlastigkeit | - |
|
-- |
-- |
Legende: Der durch Verwendung des Internets zu erwartende Lösungsbeitrag
ist vermutlich ...
| ++ | sehr hoch | - | niedrig | --- | kontraproduktiv |
| + | hoch | -- | sehr niedrig |
|
ohne Zusammenhang |
| ? | unklar |
Das Internet kann im Kontext sozialwissenschaftlichen Lehrens und Lernens zwei Basisfunktionen erfüllen, es kann Medium oder Thema sein. Beim Internet als Medium werden meist drei Funktionen unterschieden: Information, Kommunikation und Präsentation (Harth 1998, 348f.); genauer wäre statt Präsentation von Publikation zu sprechen. Manche ergänzen eine Kooperationsfunktion, z.B. für die schulübergreifende Projektarbeit, andere eine Partizipationsfunktion (Meeh 1997, 222; Harth/Simon 1997, 202). Internetkooperation heißt über Internetdienste kommunizieren und vielleicht die gemeinsamen Ergebnisse präsentieren; bezogen auf das Internet bedeutet Partizipation ebenfalls Kommunizieren, hier zwischen Publikum und Entscheidern. Die Motivationsfunktion kann vernachlässigt werden, da sie nur vorübergehend wirkt (Hedtke 1998).
Man kann also drei mediale Funktionen des Internets unterscheiden:
Informieren, Kommunizieren und Publizieren. Informieren und Publizieren
differieren allerdings nur in der Richtung des Datenstroms; wer sich informiert,
holt Daten oder Informationen aus dem Netz, wer publiziert, gibt sie hinein.
Kommunizieren meint dagegen immer die mehr oder weniger aktive Beteiligung
eines Kommunikationspartners im Netz.
Nutzt man das Internet in seiner Basisfunktion als „Thema“,
können die beiden inhaltlichen Funktionen Thematisieren und Exemplifizieren
unterschieden werden. Die Literatur vernachlässigt die thematische
gegenüber der medialen Basisfunktion.
-
Thematisieren: Hier werden sozialwissenschaftliche Aspekte des Internets
selbst zum Thema, d.h. „das Internet“ wird unter einer
sozialwissenschaftlichen Frage- oder Problemstellung analysiert und diskutiert.
Beispiele dafür sind die Probleme der Beschleunigung gesellschaftlicher
Informationsprozesse durch elektronische Datennetze, die Chancen und Risiken
anonymer elektronischer Kommunikation oder die sozialen und politischen Folgen
ungleicher Zugangschancen zum Internet.
- Exemplifizieren: Hier wird das Internet als ein exemplarisches Beispiel verwendet, um allgemeinere sozialwissenschaftliche Themen zu bearbeiten. Das können beispielsweise sein: die Problematik der Zensur in der Demokratie (z.B. Internetnutzung durch Neonazis), der Zusammenhang von kommerziellen Interessen (hier: Telekommunikationsindustrie) und Bildungspolitik oder Technologiepolitik (z.B. „Schulen ans Netz“), die Chancen und Risiken der Informatisierung von Wirtschaft und Gesellschaft (z.B. personenbezogene Daten aus der verdeckten Protokollierung individueller Internetaktivitäten).
Wie sehr das Internet als Inhalt zu kontroverser sozialwissenschaftlicher Thematisierung herausfordert, mögen einige Zitate aus einer US-amerikanischen Position illustrieren: „Der Cyberspace ist konservativ. (...) Er begünstigt das politische Ideal der libertären, am freien Markt orientierten Republikaner: eine stark dezentralisierte, deregulierte Gesellschaft mit wenig allgemeiner Diskussion und nur einem Mindestmaß an öffentlicher Infrastruktur“ (Shenk 1998, 192). Dieses Programm harmoniert „hervorragend mit dem der Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche, was eine überaus mächtige Koalition politischer Interessen ergibt“ (S. 195). „Eine entfesselte Dezentralisierung reduziert unsere gemeinsame Information auf einen Strom trivialer Kurznachrichten und verdrängt jede echte Diskussion in die von Mikrokulturen besetzten Nischen“ (S. 196). Mit dieser genuin politischen Kontroverse könnte man sich zugleich von psychologisierend-kulturpessimistischen Ansätzen nach der Grundmelodie „das Internet macht dumm, einsam, depressiv und krank“ emanzipieren und die Internetdebatte nachhaltig politisieren.
Um die beiden Verwendungsformen Unterrichtsvorbereitung und Lerngegenstand (als Thema oder Exemplum) fachdidaktisch zu gestalten und zu beurteilen, braucht man wohl kaum neue Konzepte. Das Medium Internet bietet zahlreiche Vorteile und Chancen für die Unterrichtsvorbereitung, hier kann darauf aber nicht weiter eingegangen werden. Im folgenden geht um die Voraussetzungen dafür, dass die Chancen des Internets im Unterricht realisiert werden können.
2. Allgemeine Voraussetzungen einer angemessenen Internetnutzung
Ob das Internet überhaupt im Unterricht genutzt werden kann oder nicht, hängt zunächst von qualifikatorischen (z.B. Computer-, Browser-, Internet-, Netzwerkkenntnisse, allgemeine Informationskompetenzen), technischen (z.B. Hardwareausstattung, Leistungsfähigkeit der Anschlüsse), organisatorischen (z.B. Zugänge zu PC-Arbeitsplätzen, verfügbare Unterrichtszeit), rechtlichen (z.B. Urheberrecht, Jugendschutz) und ökonomischen Voraussetzungen (z.B. Budgets für Provider-, Telefon- und Datenbankkosten) ab (vgl. Übersicht 2). Ich beschränke mich hier auf einige Anmerkungen zu den qualifikatorischen Voraussetzungen.
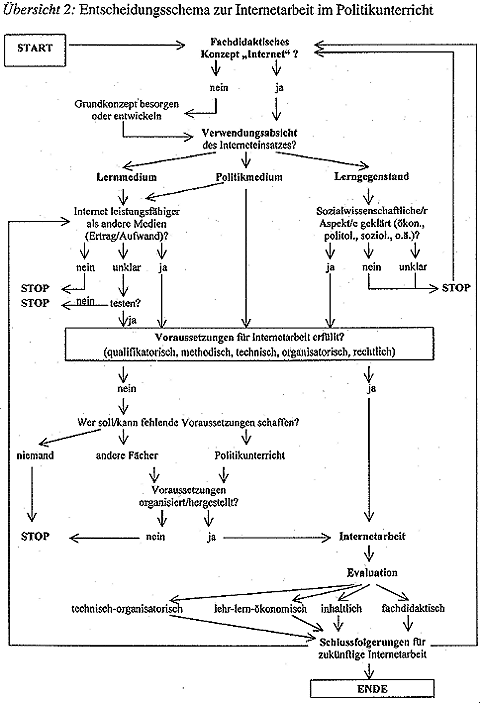
Die Internetnutzung wird gerne als neue „Kulturtechnik“ bezeichnet. Unabhängig davon, ob diese prognostische Aussage stimmt, leuchtet es unmittelbar ein, dass diese „neue Kulturtechnik“ die Beherrschung klassischer Kulturtechniken voraussetzt, nämlich vor allem Lesen und die Kompetenz, mit Informationsquellen und Informationen, besonders mit einer Masse und Vielfalt von Texten, umgehen zu können. Im Netz gibt es weder Traditionen der Seriosität und Verlässlichkeit von Informationsanbietern wie im Buch- und Presseverlagswesen noch institutionelle Angebote wie Bibliotheken, bibliothekarische Hilfen und Bibliothekare, die man fragen kann. Kataloge und Suchmaschinen können das kaum ersetzen, Datenbanken und Recherchedienste lassen sich ihre Leistungen gut bezahlen. Deshalb müssen die meisten Netznutzer, vor allem im chronisch finanzschwachen Bildungsbereich, diese Lücke durch ihre eigene Informationskompetenz und einen höheren Zeitaufwand zur Informationsevaluation schließen. Das stellt extrem hohe Anforderungen an Lernende - und/oder stärkt doch wieder die Position des Lehrenden, der im Zweifelsfall entscheidet, was seriös und vertrauenswürdig ist und was nicht. So betrachtet löst das Internet nicht nur die bestehenden qualifikatorischen Probleme nicht, sondern fügt ihnen noch neue hinzu.*4 Das verschärft zugleich die allgemeine Zeitknappheit.
Damit man eine Internetnutzung jenseits des Erwerbs eines Internetführerscheins als „angemessen“ bewerten kann, müssen weitere Kriterien erfüllt sein. Grundsätzlich muss der Einsatz des Internets eine echte Problemlösung bieten (Effektivitätskriterium). Das ist z.B. der Fall, wenn es in einem überregionalen Projekt als Kommunikationsmedium von den Partnern genutzt wird. Die Internetlösung muss darüber hinaus die fachdidaktischen oder unterrichtspraktischen Probleme besser lösen, als bekannte und bereits beherrschte Vorgehensweisen und Medien (Subsidiaritätskriterium). Ein Beispiel dafür wäre es, wenn es das Internet gegenüber konventionellen Medien erlaubte, Informationen schneller und/oder an eine breitere oder speziellere Öffentlichkeit zu verbreiten.
Bei diesen Überlegungen müssen die durch die Internetarbeit neu auftauchenden Probleme in eine Kosten-Nutzen-Abwägung eingehen; das sind vor allem unbeabsichtigten Nebenfolgen wie z.B. lange Wartezeiten, hohe Zeitbudgets für Finden, Sammeln, Sichten und Bewerten von Informationen oder Informationsüberlastung, aber auch monetäre und motivationale Kosten (Effizienzkriterium). Nach Maximen wie dem „Kartoffelprinzip“ („Sind die Kartoffeln schon mal da, werden wir sie auch essen“) oder dem „Polonäseprinzip“ („Wird zur Polonäse aufgespielt, hält man sich dicht am Vordermann“) zu handeln, verbietet sich eigentlich von selbst. Bei einer kritischen Prüfung der Angemessenheit des Interneteinsatzes im Unterricht werden sich viele Projekte als Selbstzweck entpuppen, vorwiegend gespeist aus Aktualitätsstreben, Medieneuphorie oder Belohnungshoffnungen.
Auf diesem Grund gedeiht auch das Problem der Vermüllung des Internets durch eine exponentiell wachsende Menge beliebiger, oft qualitativ schlechter Datenangebote. Dazu trägt die Publikation von Lernergebnissen aller Arten und Niveaus kräftig bei.*5 Das, wofür sich schon in der Pausenhalle außer den Verfassern kaum jemand interessieren würde, wird oft bedenkenlos ins Netz gestellt. Benötigt wird deshalb eine strenge freiwillige Selbstkontrolle, die verhindern, dass die Publikation von Produkten routinemäßig zum pädagogischen Selbstzweck wird. Da man als Pädagoge motivieren, als Lernender repräsentieren möchte und als Urheber im Internet relativ anonym bleiben kann, fällt die notwendige Selbstdisziplin bei der Netzpublikation nicht leicht.*6 Der „Infomüllanarchie“ („Jeder entsorgt seinen Abfall wo und wie es ihm gefällt“) steht bei der Internetpublikation deshalb insgesamt nur wenig entgegen.
Am wichtigsten ist es allerdings, Eckpunkte eines (fach-)didaktischen Konzeptes für den Interneteinsatz im Unterricht sozialwissenschaftlicher Fächer zu entwickeln und zu berücksichtigen. Welche Elemente sollte ein Nutzungskonzept für das Internet enthalten?
3. Aspekte eines Internetkonzepts für sozialwissenschaftlichen Unterricht
Die Nutzung des Internets verlangt neue sowie vertiefte konventionelle Informationskompetenzen. Beides zu erwerben gelingt nur durch einen relativ hohen Lern- und Zeitaufwand. Angesichts der knappen Zeitressourcen für politisches Lernen sollten Politiklehrerinnen und -lehrer sich auf keinen Fall darauf einlassen, dass der Erwerb grundlegender Informations- und Telekommunikationskompetenzen auf Kosten ihrer Unterrichtszeit geht. Daraus folgt, dass die Lernenden über diese Grundfähigkeiten verfügen müssen, bevor in sozialwissenschaftlichen Fächern konkret mit dem Internet gearbeitet wird. Dafür braucht man Lösungen im Gesamtcurriculum; vor allem muss man sagen, was zugunsten der Internetqualifikation wegfallen soll.
Will man das Internet zum Thema oder Exempel sozialwissenschaftlichen Lernens machen - und das halte ich für unverzichtbar -, muss ein sozialwissenschaftlich fundiertes Verständnis des Internets den Ausgangspunkt bilden. Wichtig ist, dass Lernende das Internet als soziales und politisches Phänomen verstehen und wichtige Aspekte dieses Phänomens sozialwissenschaftlich analysieren. Dazu muss das Thema Internet inhaltlich in eine sozialwissenschaftliche Perspektive gestellt werden. Man kann sich auf mindestens sechs politikdidaktischen Reflexionsebenen mit dem Internet beschäftigen (genauer: Hedtke 1999). Das Internet lässt sich konzipieren als
- soziotechnischer Raum individueller Handlungen und Erfahrungen in Form von Netznutzung und Gesprächen über das Internet („Erfahrungsraum“; z.B. E-Mail und Newsgroups als neue Formen individueller Meinungsäußerung und Meinungsbildung),
- neuer Austragungsort für kommerzielle, politische und kulturelle Konkurrenz („Arena“; z.B. Selbstdarstellung der politischen Parteien und Verbände im Internet),
-
Ausdruck der allgemeinen Informationsverhältnisse einer Gesellschaft
(„Informationsgesellschaft“, z.B. Vertiefung der Informations-
und Wissensasymmetrie zwischen gesellschaftlichen Gruppen),
-
Thema medien- und informationspolitischer, kultureller und pädagogischer
Diskurse („Mediendiskurs“; z.B. Diskussion über preiswerten
Internetzugang für alle als partizipativ begründetes Recht),
-
Zielfeld für politisch-administrative, kommerzielle und
technisch-organisatorische Regulation („Netzpolitik“; z.B. rechtlich
normierter staatlicher Zugriff auf alle Verschlüsselungscodes aller
über das Internet transportierten Daten),
- Anlass für ökonomische und politische Einreden und Eingriffe in Bildungssystem und Bildungsprozesse („Internetbildung“; z.B. Forderung nach und Förderung von Internetnutzungen in Schulen).
Diese sechs thematischen Perspektiven helfen, eine Reihe von Themen für sozialwissenschaftliches Lernen zum Phänomen Internet zu formulieren. Beispielsweise könnte es in der Perspektive „Informationsgesellschaft“ um das Internet als neues Medium der Information und Kommunikation, um seine Rolle im Kampf um Partizipation an und Kontrolle von Information und Kommunikation oder um die Eigendynamik informationeller Prozesse und Strukturen gehen. Oder im Zugriff „Internetbildung“ könnten Aspekte wie das Spannungsfeld zwischen kommerziellen und politischen Interessen sowie demokratischer Kontrolle im Public-Private-Partnership, das Verhältnis zwischen der Computerisierung und Internetisierung der Schulen und den Absatzinteressen des Telekommunikationskomplexes, die Durchsetzung subjektiver Bildungsansprüche gegenüber Ausbildungszumutungen in Richtung Daten- und Netzkonsumenten oder die Rolle von Schule und Bildung in gesellschaftlichen Konflikten um die Inhalte von Modernisierungsstrategien thematisiert werden. Als Exempel kann man am Internet beispielsweise die gesellschaftliche und politische Relevanz und Folgen von sozialwissenschaftlich-technischen Prognosen diskutieren und dabei die Ebenen „Mediendiskurs“ und „Netzpolitik“ miteinander verbinden.*7
Nutzt man dagegen das Internet als Medium und in der Funktion Informieren, sollte man sich klarmachen, dass politische Bildung hier vor allem die effiziente Umwandlung von politischen Informationen in politisches Wissen verlangt. Daten aus dem Internet sind dabei nur ein allererster, keineswegs immer richtiger Schritt. Dabei stößt man allenthalben auf das Problem der Evaluation und Validierung der recherchierten Ergebnisse. Für institutionalisiert seriöse Informationsangebote wie die des Deutschen Bundestages, von Ministerien, politischen Parteien, Wirtschafts- oder Umweltverbänden sind diese Probleme noch recht überschaubar, weil sich die anzuwendenden Prüfverfahren nicht von denen für Printmedien unterscheiden. Darüber hinaus muss Evaluation und Validierung integraler Bestandteil politischer Bildung mit dem Medium Internet werden. Als allgemeine Aspekte können gelten: Vergleich mit vorhandenen Informationen und eigenem Wissen, inhaltlicher Kern und inhaltliche Reichweite der Information, Präsentationsform, Klarheit der Darstellung, Beurteilung der Quelle, Gültigkeit und Bedeutung (Relevanz) der Informationen (vgl. Hedtke 1999). Um diese Kriterien anwenden zu können, muss man über strukturiertes sozialwissenschaftliches Wissen verfügen und erklären können, was wissenswert ist und warum.
Ein didaktisches Konzept muss auch für die Nebenfolgen des Internets im Unterricht sensibel machen. Für sozialwissenschaftliches Lernen inhaltlich relevante Nebenfolgen betreffen vor die soziale Wertschätzung der Technologie (z.B. Unterstützung der Interneteuphorie), das Medienverhalten der Lernenden (z.B. Gefahr der Bestärkung fragwürdiger Nutzungsformen) und das Geschlechterverhältnis (z.B. Gefahr der Verschärfung geschlechtsspezifischer Asymmetrien). Aber auch die Unterrichtsökonomie (z.B. Aufwand im Verhältnis zum Lernertrag) und die Unterrichtsorganisation (z.B. technische Störungsrisiken, Kontrolle gegen unerwünschte Angebote wie Pornographie oder Rechtsradikales) werden berührt.
Eine formale Nebenfolge des Interneteinsatzes ist der schon angesprochene schulische Beitrag zur Vermüllung des Netzes. Daran lassen sich eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Lernprozessen anschließen, z.B. die Problematik der Übernutzung frei zugänglicher Ressourcen, die Frage der Herausbildung und Einhaltung sozialer Normen im Umgang mit einem neuen Medium oder die Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit fördernde Explosion ungeordneter und unbewerteter Daten.
Ohne Kriterien und Konzepte droht der Internetkult im Unterricht. Gerade die Politikdidaktik muss darauf verzichten, etwas virtuellen Weihrauch auch im sozialwissenschaftlichen Unterricht zu versprengen und am Techno-Utopismus mitzubauen. Sie hat es den Lernenden zu ermöglichen, sich ihre eigene kritische Position zum Politikum Internet zu erarbeiten sowie zielgerecht, souverän und selbstbestimmt mit dem Instrument Internet politisch umgehen zu lernen. Virtuelle Kulte und mediales Marketing stören dabei nur.
Anmerkungen
-
Eine prägnante Gegenthese: „Ein Computer in jedem Klassenzimmer
ist wie ein Kraftwerk in jedem Haus. Schulen sind engmaschige Filter, nicht
weite Fenster zur Welt. Der Computer ist (...) kein Filter (...). Als
bibliotheksähnliches Hilfsmittel kann er von ungeheurem Nutzen sein.
Aber er ist nicht (...) ein an sich schon überlegenes Lernmittel. (...)
Vielmehr werden wir unseren Verstand auf die althergebrachte
Weise schulen müssen - durch Lernen“ (Shenk 1998, 83). - Datennetze erzeugen Daten wie Autobahnen Verkehr. Deshalb potenziert die Nutzung des Internets zur Unterrichtsvorbereitung in sozialwissenschaftlichen Fächern die Probleme, die man bisher mit der eigenen konventionellen Materialsammlung hatte (vgl. Hedtke/Kahler/Schwier 1997, 365), nicht zuletzt, weil die Flüchtigkeit der Internet-Dokumente zum Download auf Vorrat zwingt.
-
Deshalb werden vor allem die professionell hergestellten
Informationsdienstleistungen nachgefragt und hoch bezahlt, die aus einer
großen Datenmenge die jeweils relevanten Informationen zielgruppen-
und problemgerecht herausfiltern. Die gängigen Suchmaschinen im Internet
sind gegenüber diesen Diensten recht schwache Laienwerkzeuge, weil sie
Daten und Quellen grobmaschig und unzulänglich diskriminieren und zu
große Datenmengen durchlassen. - Ganz abgesehen davon verliert die
einzelne Information um so mehr an Wert, je größer die Gesamtmenge
der verfügbaren Informationen ist.
-
Wie abwegig die undifferenzierte didaktische Begeisterung für das Internet
ist, möge folgender, zugegeben konstruierte Vorschlag illustrieren:
Lernende z.B. einer 9. Klasse werden für die Bearbeitung einer Fragestellung
im Politikunterricht mit dem gesamten Bestand der Nationalbibliothek oder
aller Universitätsbibliotheken konfrontiert. Internetähnliche
Bedingungen entstünden dann, wenn man vorher Systematik, systematische
Kataloge, Schlagwortkataloge und Thesauri vernichten, die Standorte der Buchtitel
nach dem Zufallsprinzip kräftig durchmischen, dann mindestens jedes
zweite Buch entfernen und durch Buchattrappen, Illustrierte, Krimis,
Versandhauskataloge, Werbebroschüren und ähnliches ersetzen, jedem
Nutzer das Recht, beliebiges Material in gedruckter Form an beliebiger Stelle
hinzuzustellen, einräumen sowie den so entstandenen
„Gesamtbestand“ dieser „Bibliothek“ per Stichwortsuche
und über von irgendwelchen Nutzern frei und beliebig erstellte Leselisten
zugänglich machen würde.
-
Dabei gehen die Homepages der Schulen, die oft zu wesentlichen Teilen keinen
anderen Zweck als narzisstisch werbewirksame Selbstdarstellung vor leeren
Zuschauerräumen verfolgen, mit möglichst schlechtem Beispiel voran.
In allen Fällen, wo rechtlich oder faktisch die Schule nicht frei
gewählt werden kann, sind sie nichts als Selbstzweck und dienen der
Vernichtung personaler, organisationaler, finanzieller und netzspezifischer
Ressourcen. Soweit sie von Anbieterinteressen gesteuert ohne kontrollierten
Bezug auf Nachfragerbedarfe Informationen, insbesondere zusätzliche,
publizieren, geben sie ein klassisches Beispiel für Infosmog. Dieser
Infosmog lässt sich um Größenordnungen steigern, wenn die
Publizierung von Lernergebnissen im Netz zum Prinzip erhoben wird. Unbeantwortet
bleibt auch die Frage, woher eigentlich die Menschen die zusätzliche
Zeit für die Aufnahme zusätzlicher Informationen nehmen oder welche
Informationen sie dafür zukünftig ignorieren sollen.
-
Der „natürliche“ Reiz (und oft gepriesene Vorteil) liegt ja
gerade darin, dass es weder Schulleiter, noch Redakteur, noch Lektor gibt,
die entscheiden, ob etwas veröffentlichungswürdig ist. Man bekommt
auch keine unmittelbaren Rückmeldungen, z.B. von Schülern aus der
Parallelklasse.
- Prognosen zur Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik haben sich in der Vergangenheit aus theoretischen, praktischen und politischen Gründen als äußerst unzuverlässig erwiesen.
Literatur
Beck, Klaus (1999): Das Computernetz als pädagogische
„Wunschmaschine“. Prognosen über den Einsatz und die Folgen
computervermittelter Kommunikation im Bildungswesen.
Quelle:
http://wwwjtg-online.deljahrbuch/online/Online-Artikel/beck/beck.html
(22.01.1999).
Euler, Dieter (1998): Multimediale und telekommunikative Lernumgebungen zwischen
Potentialität und Aktualität: Eine Analyse aus
wirtschaftspädagogischer Sicht.
Quelle:http://www.wiso.uni-erlangen.de/WiSo/BWI/WiPd/seiten/virtpubl.html
(22.01.1999).
Grammes, Tilman (1998): Kommunikative Fachdidaktik. Politik, Geschichte,
Recht, Wirtschaft. Opladen.
Harth, Thilo (1998): Erweiterung der fachdidaktischen Perspektive durch das
Medium Internet? Theoretisches Potential und praktische Erfahrungen. In:
PÄD Forum 11 (1998) 4, 348-350.
Harth, Thilo; Simon, Thomas (1997): Das Internet als Gegenstand und Medium
politischer Bildung. In: Praxis Politische Bildung (1997) 3, 195-205.
Hedtke, Reinhold (1999): Gesellschaft, Kommunikation und Politik. Das Internet
als Thema und Medium politischen Lernens. In: Jung, Eberhard; Retzmann, Thomas
(Hg.): Aktuelle Herausforderungen an die arbeits- und berufsbezogene politische
Bildung: Mensch, Kommunikation, Qualifikation. Neusäß (i E.).
Hedtke, Reinhold (1998): Politikdidaktik zwischen Netzeuphorie und Medienkritik.
Nüchterne Anmerkungen zum Mythos Multimedia im Internet. In:
Gegenwartskunde, 46 (1997) 4, 519-530.
Hedtke, Reinhold (Hg.) (1997): Vom Buch zum Internet und zurück. Medien-
und Informationskompetenz im Unterricht. Darmstadt.
Hedtke, Reinhold; Kahlert, Joachim; Schwier, Volker (1998):
Unterrichtsmaterialien aus dem Internet. Eine empirische Studie über
das Rechercheverhalten von Lehrenden. In: Gegenwartskunde 47 (1998) 3,
363-375.
Meeh, Holger (1997): Internet und politische Bildung. In: Gesellschaft,
Erziehung, Politik 8 (1997) 3, 130-137, u. 4, 222-227.
Shenk, David (1998): Datenmüll und Infosmog. Wege aus der Informationsflut.
München.
Willke, Helmut (1998): Systemisches Wissensmanagement. Stuttgart.
Quelle: Reinhold Hedtke: „Fahr'n, fahr'n, fahr'n auf der Datenautobahn?“, in: Gegenwartskunde 1/99, S. 497 ff.